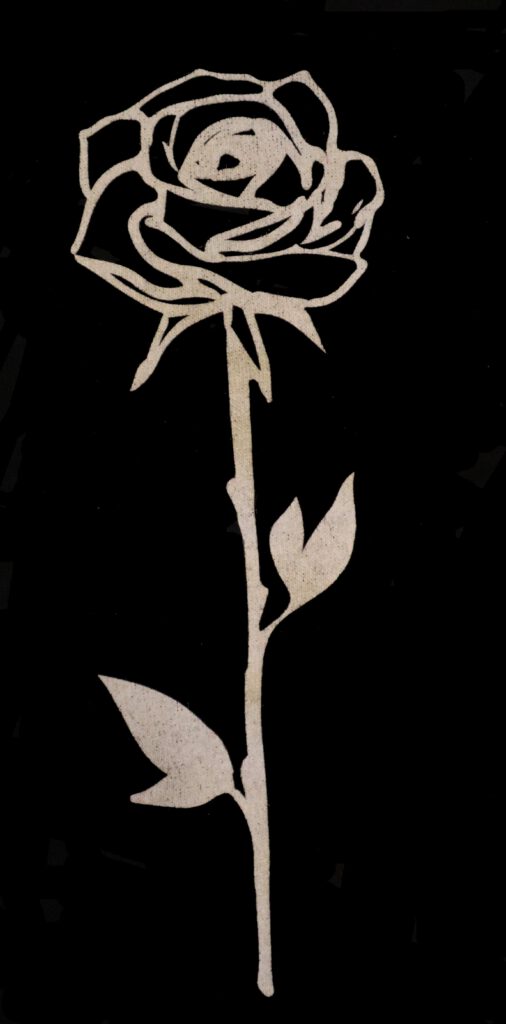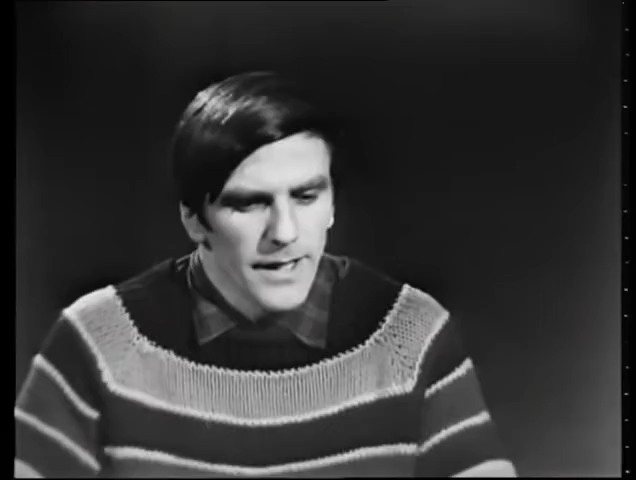Heute haben wir die Frage nach der Wiedervereinigung gelöst, doch die Verteidigung der Machtverhältnisse geht mit ähnlichen Mitteln weiter. Die Rolle der Parteien im Kampf um die bestehenden Verhältnisse hat sich eher zum Machterhalt der Mächtigen ausgeweitet. In den Jahren nach 1967 hat sich eine Politikerkaste gebildet, die abgekoppelt von den Sorgen und Nöten der Bürger handelt.
Doch welche Neuerungen in der politischen Debatte wurden als Ersatz für die Frage nach der Wiedervereinigung gefunden?
„Das ‚Höhere‘, hinter dem sich heute jeder verstecken kann, der seine Ruhe haben will, das man zugleich aber nutzen muss, wenn man auf Steuergelder aus ist oder auf einen Platz nah an der Sonne, dieses ‚Höhere‘ wurde in den späten 1960er Jahren auf den Weg gebracht und dann so verfeinert, dass es sich zu einer ‚Rechtfertigungslehre‘ verdichten ließ, die die Ordnung stabilisiert und jede Utopie erstickt. Niemand, der bei Trost ist, hat etwas gegen Gleichberechtigung, Minderheitenrechte, Umwelt- und Gesundheitsschutz. Niemand wird öffentlich für Rassismus werben, für Faschismus oder gegen Demokratie. […] Warum sollte man nicht wollen, dass sich die Verdammten dieser Erde zusammentun? Damit daraus eine Ideologie wird, eine Nebelkerze, die die Machtverhältnisse verschleiert und schützt, muss der Konsens so entkernt werden, dass er von Eigentumsfragen und allen Ungerechtigkeiten ablenkt, die damit verbunden sind, und moralisiert werden kann. Nicht richtig und falsch, sondern gut und böse. Gendergaga, Quote, CO2 , #allesindenarm, #allegegenrechts. Die Fortsetzung folgt und lässt sich eigentlich schon vorhersagen, wenn man weiß, dass im Zweifel nicht der Milliardär das Übel ist, sondern der Lastwagenfahrer aus der Oberpfalz. Weiß, männlich, westlich und damit mindestens mitschuldig am Elend der Welt. Ausbeutung und Unterdrückung? Imperialismus und Militarismus? Das gibt es nur noch in den Geschichtsbüchern, und auch dort wird permanent retuschiert.
Ideologien kommen nicht fertig in die Welt. Sie brauchen Zeit, um die Köpfe zu erobern. Sie müssen dafür in die Schulen gehen, in Lehrbücher, in Forschungsprogramme. Ich werde [noch] beschreiben, wie die Universitäten zu Brutstätten der neuen Heilslehre wurden und warum dafür ein Kommunikationsmittel nötig war, das die Wirklichkeit aus einfache Botschaften reduziert und aus allem eine Frage der Moral macht. Erst in den 2010er Jahren, als das Internet in jede Hand- und Hosentasche einzog und die ersten Jünger alt genug waren, um an Lehrpulten, auf Stimmzetteln und vor der Kamera zu stehen oder sogar nach den Schalthebeln der Macht zu greifen, erst da begann die Saat aufzugehen, die ein halbes Jahrhundert vorher von Strategen im US-Sicherheitsapparat gelegt worden war. Damit ist zugleich die Linie markiert, die die Generation teilt. Wer nach 1980 geboren wurde, ist noch kein ‚digital native‘, aber schon hineingewachsen in die neue Welt, in der ein Bologna-Studium auch deshalb immer wahrscheinlicher wurde, weil die Politik der Hochschulquote mit aller Macht nach oben gedrückt wurde.
Ich komme gleich noch einmal zurück zur Macht von Ideologienund zu den Mechanismen, über die sie wirken, will aber vorher auf das Fundament hinweisen, das der Digitalkonzernstaat errichtet hat, damit seine Geschichten geglaubt und weitergetragen werden. Die Stichworte stehen in der Kapitelüberschrift: Akademisierung und Abhängigkeiten. Im alten Westdeutschland, vor der Sattelzeit, war nicht vorstellbar, dass jeder Zweite studiert. 1960 lag die Quote in der Bundesrepublik bei sechs (!) Prozent und noch Mitte der 1980er Jahre bei nicht einmal 20. Inzwischen sind wir bei knapp 55. Der Nachkriegsjunge, der zur Universität ging, konnte selbst dann sicher sein, einen tollen Job zu finden, wenn er nach ein paar Semestern die Nase voll hatte und ohne Zeugnis ins Leben ging. Heute herrscht Knappheit überall da, wo Sinn produziert wird – in der Kultur, in den Medien, in Wissenschaft und Politik. Wohin man auch schaut, gibt es viel mehr Bewerber als Geld, Stellen, Aufstiegschancen. Die Folge: eine ‚feudale Klassengesellschaft‘ mit Fürtsen ‚auf dem Sonnendeck‘ (Intendanten, Chefredakteure, Professoren, Bischöfe, Stiftungschefs), ganz ordentliche Kabinen eine Etage tiefer (die fest Angestellten) und den ‚Abteilen der dritten Klasse‘ (Teilzeit- und Honorararbeitern, oft befristet, zu finden in Hochschulen, Redaktionen, Abgeordnetenbüros, NGOs, Warteschleifen). Diese ‚Dreiteilung‘ produtiert fast automatisch eine ‚Ökonomie des Verdachts‘, in der es einen ‚inneren Wächter‘ braucht, um die eigenen Worte und Gedanken zu kontrollieren und zugleich jeden Skrupel zu ersticken, wenn es darum geht, einen Konkurrenten als ‚Feind des gerechten Denkens anzuprangern‘.
Parallel zur Akademisierung wurde ein Arbeitsmarkt aus dem Boden gestampft, für den es einen neuen Begriff bräuchte, da er nichts mit Menschen zu tun hat, ‚die morgens früh aufstehen, um mit ihren Händen etwas in der Welt zu bewirken‘, und dies gern tun, weil sie es es können und das Leben so für viele besser machen. In der Logik dieses Kapitels müsste ich von Ideologiebeauftragten sprechen, die haupt- oder ehrenamtlich auf ganz unterschiedlichen Verwaltungsebenen installiert worden sind (wahlweise zuständig für Ausländer, Integration, Diskiminierung, Rassismus, Frauen, Queer, Lesben, Schwule, Inklusion, Antisemitismus, Antiziganismus, Klima, Nachhaltigkeit), ihre Existenz durch Leitmedienpräsens rechtferigen müssen und so in Unternehmen oder Kultur und Bildung Imitationen nach sich ziehen, zum Teil forciert über entsprechende Gesetze. Diese Armee fängt einen Teil der der akademischen Überproduktion auf und kann für den anderen Teil so verlockend sein, dass es sich lohnt, an die offiziellen Narrative anzudocken. Ähnliche Signale senden Förderinitiativen, mit denen EU, Bund, Länder und Konzernstiftungen die Universitäten auf Linie bringen, sowie der NGO-Eisberg mit Organisationen wie das Zentrum Liberalen Moderne oder der Amadeu Antonia Stiftung an der Spitze, die die Regierungsnarrative mit Flak unterstützen. Die nötigen Kampfbegriffe finden sich in Politikerreden und akademischen Texten: Fake News, Hass und Hetze, Verschwörungstheorien, Populismus. Jeder dieser Begriffe ist im öffentlichen Bewusstsein seit Mitte der 2010er Jahre mit einem Warnblinker verknüpft: Achtung ‚die Demokratie‘ ist in Gefahr! Was genau damit gemeint ist, bleibt in aller Regel schon deshalb offen, weil Machtkontrolle sowie die Beteiligung der Vielen an Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, die Strahlkraft der ‚Leitidee‘ Demokratie ausmachen und schnell offenkundig werden würde, wie weit weg dieses Ideal von der Lebenswirklichkeit in westlichen Gesellschaften ist. Stattdessen wird die Drohkulisse je nach Kontext mit ‚Rassismus‘ angereichert (USA) oder mit ‚Rechtsextremismus‘ und ‚Antisemitismus‘ (Deutschland).
Wenn ich ganz oben sitzen würde, an den Fleischtöpfen der Macht, würde ich mir die Hände reiben. Gut gelaufen – auch für Konzerne, Finanzindustrie und Vermögensverwalter, die spätestens seit dem Crash von 2008 auf der Suche nach Legitimation waren. DEI (Diversity, Equity, Identity) und ESG (Environmental, Social, Governance) sind viel billiger zu haben als Tarifverträge oder gar Gewerkschaften und für die Talente von morgen zugleich eine Honigfalle: Dieses Unternehmen, liebe Leute, produziert vielleicht Dinge, die die Welt nicht braucht, das alles aber hat einen höheren Sinn. Damit lassen sich nicht nur Bewerber fangen, sondern auch Kunden – zuallererst die nächsten Generationen, die sich selbst einreden, Umwelt und Gerechtigkeit auf dem Schirm zu haben, und sich so nicht nur von ihren Eltern absetzen wollen, sondern auch von der ’stumpfen Unterschicht‘. Die ‚Besessenheit‘, mit der junge und nicht mehr ganz so junge Akademiker und Medienleute nach den Brocken greifen, die ihnen dahingeworfen wurden, ‚funktioniert wie ein riesiger Schild, der die eigentliche Kluft verdeckt‘ – die Klassenlinie, immer schwer zu überschreiten und so zerstörerisch wie nie zuvor. Die da oben sind reaktionär und eine Gefahr für uns alle hier unten? Die ‚Hauptrichtung der Gesellschaftskritik verläuft neuerdings‘ umgekehrt. ‚Für diesen Zaubertrick empfinden die Lenker großer quasimonopolistischer und mit der Politik verflochtener Konglomerate zu Recht eine tiefe Dankbarkeit.‘ Man könnte soger von einer Win-Win-Situation sprechen, da der Verzicht auf jeden Klassenkampf den Status-Quo sichert und dabei auch die eigene Position. Wer sich selbst dafür anklagt, weiß zu sein, westlich und mannchmal auch noch männlich, der muss nicht wirklich etwas tun. All das kann man schließlich nicht ändern. Schuldgefühle kosten nichts. Und: Wenn die Deutungseliten bunter werden, kann man weiter glauben, es aus eigenem Verdienst geschafft zu haben – über Talent, Anstrengung, Intelligenz,. Soziale Ungleichheit verschwindet so aus der Realität von Leitmedien, Wissenschaft und Politik, wird aber in der Wirklichkeit trotzdem immer größer.
Es hat gedauert, bis die neue ‚Rechtfertigungslehre‘ zu einer materiellen Gewalt werden konnte.“
Michael Meyen: Der dressierte Nachwuchs – Was ist mit der Jugend los? S. 36-41, Berlin, 2024
Der „woke“ Mensch als Bürger, als Wähler, als Ideal der Mächtigen
Wer 1988 die 10. Klasse einer Realschule besuchte und in diesem Jahr seinen Abschluss, die Mittlere Reife, machte, musste sich vorher überlegt haben, wie es nach den Sommerferien weitergehen sollte. Einige gingen nach den Ferien weiter zur Schule und strebten die Allgemeine Hochschulreife, das Abitur, an. Der Rest fing eine Ausbildung im Handwerk an oder man ging in den kaufmännischen Bereich oder auch die Verwaltung. Etwa 20 Prozent meines Jahrgangs absolvierte ein Hoschulstudium. Dieses war noch frei. Wir erstellten unseren eigenen Stundenplan, wählten Vorlesungen und Seminare und hatten die Zeit, uns auch in ungewöhnliche Themen einzuarbeiten.
80 Prozent meines Jahrgangs waren also mit etwa 16 Jahren im Berufsleben und waren frei von staatlichem Einfluss durch Schule oder Hochschule. Sie waren somit auch freier im Denken und konnten sich mehr auf sich selbst konzentrieren, auf die Sorgen und Nöte eines Heranwachsenden in Ausbildung. Dies sind natürlich andere Voraussetzungen als für die Jugend einer Gesellschaft, in der über die Hälfte an die Hoschulen strebt und einen Hoschulabschluss macht. Sie sind viel länger im Bildungssystem. Sie können also viel länger an die großen Probleme unserer Zeit herangeführt werden: Klimakrise, Rassismus, Genderrismus, Wokeismus, die Schuld des weißen CIS-Mannes, die Schuld der Nationen, die Schuld der Deutschen …
Gleichzeitig ist die Auswahl an akademischen Beschäftigungsstellen gewachsen, wobei die meisten Stellen in NGOs, den Medien oder staatlichen Stellen zu finden sind. In diese gelangt man nur, wenn man das richtige Lied singt, doch dies wurde einem ja von Schulbeginn an beigebracht. So sind viele Menschen heute davon abhängig, der Ideologie der Mächtigen zu folgen und hatten gar nicht die Chance sich zu einem mündigen, aufgeklärten Menschen zu entwickeln, der sich seines eigenen Verstandes bedient. Die heutige Jugend wurde gezwungen, der Ideologie der Mächtigen zu folgen. Andere Gedanken führen zur gesellschaftlichen Ausgrenzung. Und das kann niemand wollen. Die Menschen, die es sich leisten können verlassen jedes Jahr das Land zu tausenden. Die anderen bleiben hier und spielen das Spiel der Mächtigen mit.
Die Postmoderne als Triebkraft der Ideologie der Mächtigen
Wenn oben bedauert wurde, dass die Jugend keine Chance hatte, sich zu einem mündigen, aufgeklärten Menschen zu entwickeln, dann darf man das bedauern, doch so ist es gewollt. Die Herrschaftsideologie der Mächtigen beruht auf dem philosophieschen Konstrukt der Postmoderne. Wenn die Menschen bis zur zweiten Jahrtausendwende mit dem Ideal des aufgeklärten Menschen aufgewachsen sind, so werden die Kinder des zweiten Jahrtausends als Mensch der Postmoderne sozialisiert. Dabei stehen Aufklärung und Postmoderne in zentralen Punkten sehr unterschiedlich, wenn nicht gar widersprüchlich zueinander. Ich möchte diese Unterschiede an einigen Kernaussagen der Philosophie aufzeigen.
Vernunft und Wahrheit
aus Sicht der Aufklärung:
Die Aufklärung, die im 17. bis 18. Jahrhundert entstand, stellt die Vernunft als oberstes Prinzip in den Vordergrund. Philosophen wie Kant, Locke und Voltaire vertraten die Idee, dass der Mensch durch Vernunft und Wissen die Wahrheit erkennen und die Gesellschaft verbessern kann. Die Aufklärung glaubte an objektive, universelle Wahrheiten, die durch rationales Denken zugänglich sind.
aus Sicht der Postmoderne:
Die Postmoderne, die Mitte des 20. Jahrundert entsstand, hinterfragt die Annahme einer universellen und objektiven Wahrheit. Für postmoderne Denker wie Lyotard, Derrida und Foucault sind Wahrheiten sozial konstruiert und oft Ausdruck von Machtstrukturen. Die Postmoderne sieht „Wahrheit“ als relativ und vielschichtig und betont den Einfluss von Sprache, Kultur und sozialer Stellung auf unser Verständnis von Realität.
Wissen und Fortschritt
aus Sicht der Aufklärung:
Die Aufklärung geht davon aus, dass Wissen zu Fortschritt führt. Wissenschaft, Bildung und technologische Entwicklung sind der Weg zu einer besseren, aufgeklärten Gesellschaft, in der Menschen mehr Freiheit und Wohlstand genießen können.
aus Sicht der Postmoderne:
Die Postmoderne ist skeptisch gegenüber der Idee des linearen Fortschritts und kritisiert die Fortschrittsgläubigkeit der Aufklärung. Postmoderne Denker betrachten Fortschritt nicht automatisch als positiv und weisen auf die Gefahren hin, die durch Technologie, Wissenschaft und Machtmissbrauch entstehen können, wie z. B. Umweltzerstörung und soziale Ungleichheiten.
Mensch und Individuum
aus Sicht der Aufklärung:
Die Aufklärung betont das autonome Individuum, das über Rationalität verfügt und unabhängig von Traditionen und Autoritäten denken kann. Die individuelle Freiheit und die Rechte des Einzelnen sind zentrale Anliegen der Aufklärung. Diese Gedanken sind die Grundlage unserer Demokratie und sind der Boden, auf dem das Grundgesetz steht.
aus sicht der Postmoderne:
Die Postmoderne relativiert das autonome Individuum. Sie sieht das Individuum als „dezentriert“ und durch gesellschaftliche, kulturelle und sprachliche Strukturen beeinflusst. Die Vorstellung von einem rationalen, unabhängigen Subjekt wird als Ideal hinterfragt und als sozial konstruiert interpretiert.
Gesellschaft und Macht
aus Sicht der Aufklärung:
Die Aufklärung strebt eine gerechte, aufgeklärte Gesellschaft an, die durch rationale Gesetze, Menschenrechte und Demokratie verwirklicht wird. Es wird angenommen, dass Macht legitim sein kann, wenn sie auf Vernunft und Gerechtigkeit basiert. Dabei soll jedem Individuum der Zugang zur Macht ermöglicht werden.
aus Sicht der Postmoderne:
Die Postmoderne sieht Macht als allgegenwärtig und oft als verdeckt manipulierend. Foucault etwa analysiert Macht als etwas, das durch Sprache, Institutionen und Wissen ausgeübt wird, oft auf subtile Weise. Die Postmoderne betont, dass Machtverhältnisse immer hinterfragt werden sollten und dass keine gesellschaftlichen Strukturen frei von Macht sind.
Sprache und Bedeutung
aus Sicht der Aufklärung:
Sprache dient der Übermittlung von Wissen und der Vermittlung von objektiver Wahrheit. Worte und Begriffe haben eine eindeutige Bedeutung und sind Werkzeuge des rationalen Denkens.
aus Sicht der Postmoderne:
Die Postmoderne betont die Mehrdeutigkeit und Veränderlichkeit von Sprache. Sie sieht Sprache nicht nur als Mittel zur Übermittlung von Informationen, sondern als etwas, das die Realität formt und konstituiert. Derrida und andere dekonstruieren Sprache, um zu zeigen, wie instabil und vielschichtig Bedeutung ist.
Wissenschaft und Skepsis
aus Sicht der Aufklärung:
Wissenschaft wird in der Aufklärung als wichtigstes Instrument zur Erkenntnisgewinnung betrachtet und ist eng mit Vernunft und Wahrheit verbunden. Naturwissenschaftliche Entdeckungen und empirische Methoden gelten als verlässlich und objektiv.
aus Sicht der Postmoderne:
Die Postmoderne zeigt sich skeptisch gegenüber den objektiven Ansprüchen der Wissenschaft. Sie sieht Wissenschaft als einen Diskurs, der ebenso von Machtstrukturen durchzogen ist und ideologischen Interessen dienen kann. Naturwissenschaftliche Wahrheiten werden oft als eine von mehreren möglichen „Wahrheitsansprüchen“ betrachtet, abhängig vom kulturellen und historischen Kontext.
Zusammenfassung
Die Aufklärung und die Postmoderne haben grundlegend unterschiedliche Sichtweisen auf die Möglichkeiten und Grenzen menschlicher Erkenntnis.
Aufklärung:
Optimistisch und fortschrittsorientiert, vertraut sie auf Vernunft, universelle Wahrheit und die Möglichkeit eines autonomen, rationalen Individuums. Sie glaubt, dass Wissen objektiv und in eine universelle Ethik eingebettet ist.
Postmoderne:
Skeptisch und relativistisch, kritisiert sie die universalistischen Ansprüche der Aufklärung und betont den Einfluss von Macht und Kultur auf Wissen und Identität. Sie sieht Wissen als konstruiert und betont, dass das Subjekt, die Wahrheit und die Bedeutung immer im Wandel sind und durch verschiedene gesellschaftliche Kräfte beeinflusst werden.
Das Selbstbestimmungsgesetz stammt aus der postmodernen Gedankenküche
Am 1. November 2024 trat das Selbstbestimmungsgesetz in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Jeder kann jetzt selbst bestimmen, ob er Mann oder Frau ist. Nicht mehr die Genetik als spezieller Bereich der Biologie entscheidet über die Begriffe männlich oder weiblich (XY-Chromosomensatz und XX-Chromosomensatz). Entscheident ist das Gefühl des einzelnen Individuums, das über das Geschlecht entscheidet. Damit werden alle Schutzräume für Frauen hinfällig. Wenige Menschen fühlen sich als Fuchs oder Tieger, Meerschweinchen oder Schlange. Nach dem Postmodernismus ist der Mensch ein Fuchs usw., denn sein Gefühl entscheidet darüber, was er ist.
In der Postmoderne zählt die Gruppenidentität und nicht der Individualismus. Wie verträgt sich das mit dem Selbstbestimmungsgesetz als Auswuchs der Postmoderne?
„Postmoderne Theoretiker betrachten die Vorstellung eines autonomen Individuums im Wesentlichen als Mythos. Das Individuum ist, wie alles andere auch, ein Produkt von Machtdiskursen und kulturell konstruiertem Wissen. Nicht anders verhält es sich mit mit dem Konzept des Universellen, das bestenfalls als naiv angesehen wird – seien es universelle biologische Aussagen über die Natur des Menschen (wie die, dass es nicht mehr und nicht weniger als zwei Geschlechter gibt) oder universelle ethisch-moralische Aussagen, die zum Beispiel gleiche Rechte und Freiheiten für alle Individuen fordern. Im schlimmsten Fall gilt das Universelle der postmodernen Theorie als eine weitere Zementierung von ‚Macht/Wissen‘ (ein Begriff von Michel Foucault der Wissen und Sprache als Werkzeug der Macht identifiziert), das der Allgemeinheit die herrschenden Diskurse aufzwingt. Die postmoderne Sichtweise verwirft das Individuum und somit den Grundbaustein einer jeden stabilden und gesunden Gesellschaft. Sie rückt stattdessen verschiedene Gruppen als Wissens-, Werte- und Diskursproduzenten in den Mittelpunkt. Folglich konzentriert sich der Postmodernismus auf Gruppen, von denen angenommen wird, dass ihre gleiche soziale Positionierung, etwa durch ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, körperliche Konstitution oder Klassenlage charakterisiert, zu den gleichen Erfahrungen und Wahrnehmungen führt und sie somit zu einer Einheit macht, die im Machtkampf mit den anderen Gruppen steht und ihre geteilten Charakteristika daher zelebrieren und glorifitieren muss, damit sie sich in jenem Machtkampf behaupten und die ‚Unterdrücker‘ stürzen kann.“
ExpressZeitung: Wokeismus – Der Westen gibt sich auf. S. 13 f., Ausgabe 55, Juli 2023
Das Individuum wird also durch eine Gruppenzugehörigkeit ersetzt. Unterschiedliche Gruppen (im Bereich der sozialen Medien als Blasen oder Bubbles bezeichnet) kämpfen gegeneinenander um mehr Macht. Macht durch Abgrenzung gegen andere. Dabei besitzen die unterschiedlichen Gruppen verschiedene „Privilegien“. Je mehr gesllschaftliche Privilegien man besitzt, desto höher ist die individuelle Macht der Gruppenmitglieder. Der weisse, heterosexuelle, christliche, 1,90 Meter große, deutsche Akademiker hat mehr Privilegien als die ungelernte, schwarze Küchenhilfe.
Eine Privilegienstruktur von mächtig bis ohnmachtig, die man auch als Opferhierarchie in umgekehrter Reihenfolge deuten kann, könnte wie folgt aussehen:
- weiss
- heterosexuell, CIS
- christlich, atheistisch
- gesund
- schlank
- Mann
- nicht behindert
- BIPOC
- queer
- jüdisch, muslimisch
- (chronisch) krank
- mehrgewichtig
- Frau, divers
- behindert
Hier zersplittert die aufgeklärte Gesellschaft am Fels der Postmoderne. Nicht mehr das Gemeinsame soll in der postmodernen Gesellschaft der Leitfaden sein, sondern der Kampf unter den unterschiedlich Priviligierten soll das Gerüst der postmodernen Gesellschaft sein. Einigkeit und Recht und Freiheit für jedermann werden durch postmoderne Begriffe ersetzt. Ist das nicht ein Angriff auf die grundlegenden Werte unseres Zusammenlebens und der Grundwerte, die der Nährboden des Grundgesetzes sind? Unter diesem Aspekt ist das Selbstbestimmungsgesetz ein Sieg für die Postmoderne und eine klare Abkehr von der Aufklärung und damit von den Grundfesten unseres gesellschaftlichen Nährbodens.
Identitätskrise – Kritik an der aufgeklärten Gesellschaft
phoenix – unter den linden
Faschismus ist nicht nur rechts zu finden
Da ich mich seit über 35 Jahren mit Faschismus beschäftige, habe mich schon oft gefragt, ob wir in den Auswirkungen postmodernen Denkens, das man eher politisch links einordnen kann, nicht faschistische Züge sehen können. Zu dieser Frage möchte ich die Sichtweise der umstrittenen Politikwissenschaftlerin Dr. Ulrike Guérot vorstellen.