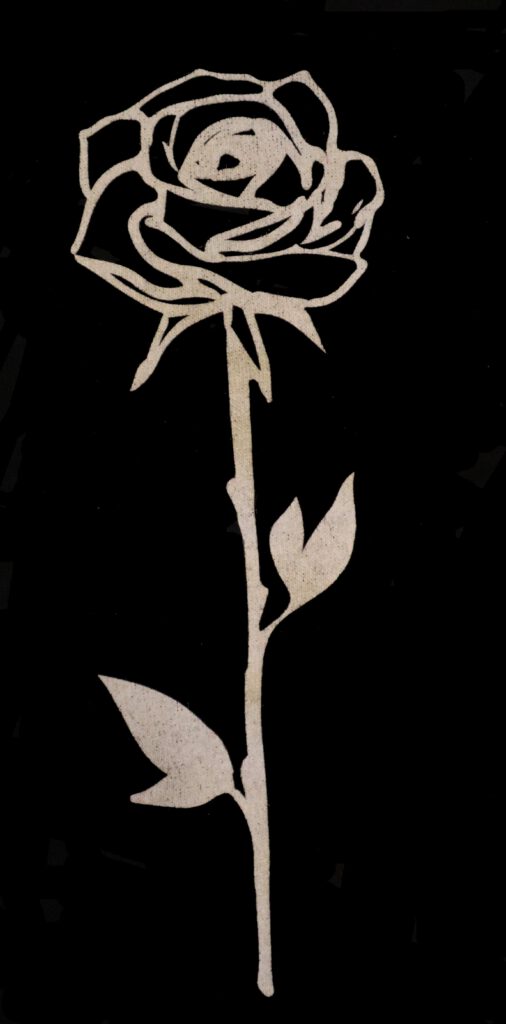Wokeismus als praktisches Konzept der Postmoderne
Ich frage mich häufig, wer oder was dafür gesorgt hat, dass sich die Denker unserer Gegenwart und mit ihnen die Medien als ihr Sprachrohr, von der Aufklärung und Moderne als Grundlage unseres Denkens, abgekehrt haben. Dazu möchte ich folgenden Artikel vorstellen, der mir Aufklärung gebracht hat:
„Der westliche Durchschnittsmensch der Gegenwart, der weder sozialwissenschaftlich bewandert noch politisch nennenswert aktiv ist, findet sich momentan in einer Gesellschaft wider, die sich in den letzten 10-15 Jahren in atemberaubendem Tempo verändert hat. Dabei weiss er selbst nicht, wie ihm geschieht: Zunehmend nimmt er Stimmen in den Medien wahr, die von ‚Dekolonisierung‘ sprechen, ‚Kulturelle Aneignung‘ beklagen und sich über die fehlende Repräsentation bestimmter ‚Identitätsgruppen‘ in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft beschweren. ‚Diversität‘, ‚Inklusivität‘ sowie ‚Sensibilität‘ für LGBTQ- und Rassismus-Themen sind gleichermassen Begriffe, die sich im öffentlichen Debattenraum häufen. Doch Menschen aller Alters- und Sozialschichten verstehen häufig nicht, was es mit dieser scheinbar omnipräsenten Toleranz-Besessenheit auf sich hat, geschweige denn, welche Hintergründe und Absichten damit einhergehen. Was das Ganze umso verwirrender macht, ist die Tatsache, dass sich Berichte über Mitmenschen häufen, die entlassen, ‚gecancelt‘ (also aus einer Debatte ausgeschlossen bzw. mundtot gemacht) oder in den sozialen Medien beleidift und bedroht wurden, weil sie etwas gesagt oder getan haben, das als sexistisch, rassistisch, homophob oder transfeindlich interpretiert wird. Stehen diese Dynamiken nicht im Widerspruch zu den lautstarken Toleranz-Bekundungen von Aktivisten, Politikern, Konzernchefs und Medienmachern?
Um zu verstehen, was sich heute vor unser aller Augen abspielt, müssen wir die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts betrachten: Damals begannen einiger Theoretiker sich mit Themen wie Wissen, Macht und Sprachen zu beschäftigen. Die daraus hervorgegangenen Konzepte tauchten in unterschiedlichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen auf und wurden später unter dem Begriff ‚Postmodernismus‘ bekannt. Dieser ist bewußt ungreifbar angelegt, doch lässt er sich am ehesten als ablehnende Haltung gegenüber der Moderne verstehen. Wissenschaft, Vernunft und Individualismus als Säulen der neuzeitlichen westlichen Gesellschaften wurden von den postmodernen Theoretikern abgelehnt. Die Wahrnehmung von der Gesellschaft als einem Zusammenspiel aus Individuen, die mit einer gemeinsamen Realität interagieren und somit Fortschritt erzielen, teilen sie nicht. Sie wollen bloss verschiedene Gruppen erkennen, die jeweils eine spezielle kollektivistische Identität innehaben und von dieser Warte aus die Welt interpretieren, ohne jemals annähernd über diese subjektive, perspektivische Sichtweise hinwegblicken zu können. Das, was wir Wissen, Wahrheit, Sinnhaftigkeit und Moral nennen, bezeichneten Postmodernisten als ausschließlich subjektives, relatives Konstrukt, welches der jeweiligen Kultur entspringt und untrennbar mit ihr verbunden ist. Der Postmodernismus verneint demnach die Existenz einer objektiven Wahrheit und besagt zudem, dass menschlichen Interaktionen auschließlich Machtinteressen zugrundeliegen, und dass die Machtdifferenz einer Gesellschaft sich in Diskursen (die Art, wie wir über Dinge sprechen) festigen.
Aus dieser Sichtweise entspringt in erster Linie ein radikaler Skeptizismus gegenüber allen Normen, Werten, Definitionen und Kategorien, da sie als Mittel zur Machterhaltung der Unterdrücker-Gruppe betrachtet werden. Postmodernisten wollen diese – ihrer Meinung nach ausschliesslich sozial konstruierten – Grenzen sprengen, um das Machtgefüge zu verschieben und die ‚maginalisierten‘ Gruppen, die aufgrund ihrer blossen gesellschaftlichen Stellung stets moralisch überlegen seien, zu unterstützen. Als unmoralische, dominante Unterdrücker-Gruppe wollen sie weisse heterosexuelle Männer westlicher Herkunft ausgemacht haben.
Erst in den 80er Jahren machte sich eine zweite Generation von Postmodernisten daran, konkrete gesellschaftspolitische Ziele zu formulieren und aktiv zu verfolgen. Die beschriebene Absicht, die bisherige Ordnung zu dekonstruieren, konnte fortan zunehmend anhand konkreter aktivistischer Maßnahmen beobachtet werden. Mit einer radikal-skeptischen Haltung (die sich aufgrund ihrer ideologischen Natur von der vernünftigen wissenschaftlichen Skepsis grundlegend unterscheidet) wurde praktisch jedes noch so kleine gesellschaftliche Phänomen kritiisert und dareufhin gefordert, es über den Haufen zu werfen. Postmodernisten stürzen sich zum Beispiel auf die Sprache, die von ihnen als Motor der Unterdrückung angesehen wird. Man begann das gesprochene wie auch das geschriebene Wort so lange und ‚genau‘ auf ‚Diskriminierung‘ zu untersuchen, dass man nur ‚fündig‘ werden konnte. Dem Empfänger einer gehörten oder gelesenen Botschaft ein Missverständnis zu unterstellen ist laut Postmodernismus unzulässig, da es keine objektive Dimension gibt – ausser eben die, dass die Wahrnehmung des Empfängers darüber entscheidet, ob Diskriminierung stattfindet oder nicht. Im Verlauf der Zeit präzisierte der Postmodernismus allerdings, dass die Regel nur zutreffe, wenn der Empfänger einer ‚marginalisierten‘ Gruppe (Frauen, ehtnische Minderheiten, LGBTQ) angehöre. Deren ‚Marginalisierung‘ wurde schlicht a priori vorausgesetzt, ohne dafür hinreichende Argumente oder Beweise zu liefern. […]
Neben der Sprache wurden auch sämtliche Kategorien wie die der Geschlechter und sogar die Definition von Behinderungen angegriffen – mit dem Versuch, sie aufzuweichen und denjenigen, die sie für gültig, logisch und sinnvoll halten, eine diskriminirende und ‚machthungrige‘ Geisteshaltung zu unterstellen. Besonders rasant wurde – und wird nach wie vor – mit dem Vorwirf des Rassismus um sich geworfen. Wenn es nach den postmodernen – ‚woken‘ Aktivisten geht, steckt er in den westlichen Gesellschaften überall, da Weisse inhärent rassistisch seien. Diese Vorwürfe und eine ihrer theoretischen Grundlagen, die sogenannte ‚Postkoloniale Theorie‘, wollen wir uns im kommenden Abschnitt […] im Detail ansehen.“
ExpressZeitung: Wokeismus – Der Westen gibt sich auf. S. 28, Ausgabe 55, Juli 2023